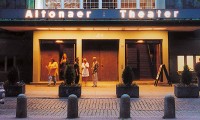Aufführungen / Theater
Deutsches Schauspielhaus Hamburg
Hamburg, Kirchenallee 39
- Morgen: A Perfect Sky
- Uraufführung: alphabet
- Premiere: Die Schönen und das Biest
- Société Anonyme
- Das große Heft
- Die Möwe
- Ein Schaf fürs Leben
- Bernarda Albas Haus

- ANTHROPOLIS I: Prolog / Dionysos

- ANTHROPOLIS II: Laios

- ANTHROPOLIS III: Ödipus

- ANTHROPOLIS IV: Iokaste

- ANTHROPOLIS V: Antigone
- Ein Sommer in Niendorf
- Das Bildnis des Dorian Gray
- Die Präsidentinnen

- Krabat

- Herr Puntila und sein Knecht Matti

- Vampire’s Mountain
- Fühler

- Momo

- Hamlet
- Virtueller Rundgang
- Der Zuschauerraum des Schauspielhaus zählt zu den schönsten Theaterräume Deutschlands.

Aufführungen
| Oper

Aufführungen
| Aufführung
All New People
The English Theatre of Hamburg
SOMETIMES ROCK BOTTOM COMES WITH ROOM SERVICE What could be more annoying than being interrupted while trying to end your own life? In a sleek New Jersey beach house, Charlie is ready to end it all. He climbs onto a chair, cigarette in hand, prepared for his final, dramatic exit–when the door bursts open. Enter Emma, a fast-talking British real estate agent who stumbles in just in time to ruin his plans. And she’s only the beginning. Soon, a fireman-turned-drug-dealer and a high-priced escort arrive, each with their own chaotic baggage. What follows is a wildly funny, unexpectedly heartfelt night where four strangers–all broken in their unique ways–collide and maybe even connect. Zach Braff’s (SCRUBS and GARDEN STATE) ALL NEW PEOPLE is a darkly comedic look at loneliness, and the bizarre ways we save each other–whether we mean to or not.
Aufführungen
| Aufführung
PROOF
The English Theatre of Hamburg
With her father dead, Catherine faces a new challenge: holding on to her own mind amidst the chaos he left behind. Stricken by grief, Catherine is caught in a whirlwind of emotions, standing amid the ashes of her father’s life–a renowned mathematician whose brilliance was overshadowed by mental illness. Isolated from everyone but his daughter, his life ended in incoherence. And Catherine is certain she has inherited more than just his genius. When her sister Claire returns home to take control of the situation, and Hal–one of her father’s former students–begins to poke around the house, a startling mathematical proof comes to light: one that could shake the entire academic world. PROOF is the gripping story of sisterhood, fragile trust, and the delicate balance between genius and madness. At its heart are the bonds that hold a family together, the sparks of romance, and the search for proof–both mathematical and personal.
Aufführungen
| Schauspiel
Der zerbrochne Krug
Thalia Theater
Premiere: 28.3.2026 Ein zerbrochener Krug steht am Beginn der Geschichte, die von Justizbetrug, Vertuschung, Gewalt und Scheinheiligkeit erzählt. Frau Marthe erscheint im Gericht, in den Händen den zerschlagenen Krug. Als Schuldigen will sie Rupprecht, den Verlobten ihrer Tochter Eve, ausmachen. Richter Adam will ohne weitere Prüfung die Verurteilung vollziehen, um den Vorgang schnell vom Hals zu haben. Doch ganz so einfach gestaltet sich der Prozess nicht. In Kleists böser Komödie ist Wahrheit der Gegenstand, der die Beteiligten am wenigsten interessiert. Hier wollen Verhältnisse gehalten und Macht gesichert werden. Doch zart und stetig bildet sich eine Gegenkraft, die die Mächtigen und ihre Mittel überführt.
Aufführungen
| Schauspiel
Baracke
Thalia in der Gaußstraße
Premiere: 21.3.2026 Für Rainald Goetz beginnt 2011 die Verfinsterung unserer Welt mit der Aufdeckung der Morde des selbsternannten Nationalsozialistischen Untergrund NSU. Als rasender Chronist der Gegenwart führt er die Liebesgeschichte zwischen Beate und Uwe mitten hinein in die deutsche Kleinfamilie. In diesem explosiven Setting wird der Hass ausgebrütet und in politischen Terror überführt. Regie führt Stefan Pucher, der mit Goetz nicht nur die künstlerische Heimat in der Popkultur sondern auch eine klare Haltung teilt.
Aufführungen
| Schauspiel
Zünzle
Thalia in der Gaußstraße
Uraufführung: 1.3.2026 Die Spitzengardinen sind beiseitegezogen, das gute Geschirr im Karton verstaut. Eine junge Frau und ihre Großmutter sitzen zwischen den Dingen, die von einem Leben übrig geblieben sind. Gemeinsam versuchen sie, das Unbegreifliche zu fassen und sich noch einmal zu erinnern: an den Wald vor der Tür, an gemeinsame Besuche im Solebad, an Gute-Nacht-Geschichten und Entstehungsmythen. Sie geben sich ihren Fantasien hin, spielen mit Erinnerungen und deren Erzählsträngen und nehmen einander an die Hand, um alte wie neue Brandherde zu entfachen. Schmerz und Trauer um einen geliebten Menschen werfen die Frage auf, was angesichts ökologischer Verluste von einem selbst noch bleibt. Das gemeinsame Erinnern wird zur treibenden Kraft, mit der sie sich dem Verlust lebenslustig entgegenstemmen. Wie kann man sich an die Stimme eines Menschen erinnern? Wie an einst lebendige Wälder und Moore, wenn durch Hitze und Dürren ganze Landschaften trist und leblos werden? Kaija Knauers Dramentext »Zünzle« lässt mit unvergänglicher Kraft Klimatrauer und persönliche Erinnerungen ineinandergreifen. Ihr Text wurde für den Preis für junge Dramatik am Staatstheater Braunschweig nominiert und durch die Wiener Wortstätten gefördert. Regisseur Ilario Raschèr schloss 2024 sein Regiestudium an der HFMT Hamburg ab und bringt ihren Text erstmals auf die Bühne. Dauer: 1 Std., keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
To My Little Boy
Thalia in der Gaußstraße
Aaron ist vierzig, Geologe, schön und gesund, hat sein religiöses Elternhaus hinter sich gelassen und stattdessen das Partyleben genossen. Alles könnte fabelhaft sein – doch irgendwie klappt es trotzdem nicht mit dem Sinn im Leben. So sehr er sich auch müht, letztlich ist da nur sein Plüschschwein Tupper, das ihm Halt verspricht. Caren Jeß schreibt ein Stück über die absolute Überforderung in der Gegenwart. Sie spannt den Bogen zwischen der Angst vor dem Weltende, der Unfähigkeit, sich zu verstehen, und der ewigen Sehnsucht nach der Sicherheit in der Liebe. Rasend komisch und zutiefst ehrlich trifft sie den Geist einer Generation, die dem Schwindel der sich selbst überholenden Zeit entgegentreten muss. Regie: Marie Bues Bühne: Heike Mondschein Kostüme: Amit Epstein Musik: Lila Zoe Krauss Dramaturgie: Nora Khuon Dauer: 1 Std. 40 Min., keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
Sankt Falstaff
Thalia Theater
Shakespeare für heute – der österreichische Autor Ewald Palmetshofer versetzt das Königsdrama Heinrich IV in unsere politische Gegenwart. Sein Stück Sankt Falstaff seziert die verrohte Welt einer sterbenden Demokratie. Als Stück der Stunde entlarvt es durchaus komödiantisch und mit viel Sprachwitz eine Machtpolitik, die sich mit Lügen und Gewalt unangreifbar zu machen versucht. Der autoritäre Quasi-König Heinz braucht einen Nachfolger. Er ist krank, und es regt sich Widerstand im Wahlvolk. Leider verliebt sich sein Sohn Harri in Kneipenjunkie Falstaff und erkundet mit ihm den unteren Rand der Gesellschaft – bis der ehrgeizige Konkurrent Percy auftaucht. Allein der heilige Narr Falstaff hält die Menschlichkeit hoch und der Gesellschaft den Spiegel vor. Es inszeniert die gerade zum Theatertreffen eingeladene bildstarke Regisseurin Luise Voigt. Dauer: 3 Std., inkl. Pause
Aufführungen
| Schauspiel
Herr Puntila und sein Knecht Matti
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Volksstück nach Erzählungen und einem Stückentwurf von Hella Wuolijoki / mit Musik von Paul Dessau „Geehrtes Publikum, die Zeit ist trist. / Klug, wer besorgt, und dumm, wer sorglos ist! / Doch ist nicht überm Berg, wer nicht mehr lacht / Drum haben wir ein komisches Spiel gemacht.“ Bertolt Brecht sitzt abgeschnitten von der Welt auf einem Landgut im finnischen Exil. Für einen Dramatikwettbewerb überarbeitet er den Entwurf eines Volksstücks seiner Gastgeberin Hella Wuolijoki. Der Erfolg bei der Jury bleibt aus, doch nach Ende des Zweiten Weltkriegs avanciert dieses Porträt einer moralisch wie ökonomisch verschuldeten Gesellschaft, in der die Herrschaftsverhältnisse so untragbar wie unauflösbar sind, neben der »Dreigroschenoper« zu Brechts meistgespielten Stücken. Der Gutsbesitzer Puntila lässt keine Gelegenheit aus, sich dem Alkohol hinzugeben. Unaufhörlich meldet sich der Durst. Betrunken zeigt er sich gesellig und empathisch, macht Versprechungen, führt sein moralisches Gewissen spazieren, sieht sich als Opfer seiner Rolle, wirbt bei seinen Untergebenen um Verständnis für seine Besitzverhältnisse und die Macht, die daraus resultiert. Wie gerne wäre er ein anderer. Wie gerne verhielte er sich menschlich, wäre wie Matti, sein Chauffeur, dem er jedoch in nüchternem Zustand keinerlei Rechte zuspricht – zumal dieser ein „Roter“ ist, eine drohende Gefahr, einer, der sich organisieren und emanzipieren könnte gegen seinen Herrn. Darum weiß Puntila, besonders in den Momenten, wenn der Durst nachlässt. Ausgenüchtert verwandelt er sich zum kalten, berechnenden Herrenmenschen, dem alles zum Geschäft wird, auch Beziehungen, selbst die eigene Tochter. Doch seine Zeit geht zu Ende. Das spürt er in jedem Moment. Auch wenn Puntila einem wie ein vorsintflutliches Tier erscheinen mag, tritt es einem erstaunlich vertraut entgegen. Es ist der Blick in die Geschichte, der sich lohne, schreibt Brecht, „weil die Ablagerungen überwundener Epochen in den Seelen der Menschen noch lange liegen bleiben.“ Wie Gespenster tauchen Figuren dieser vergangenen Zeit wieder auf, Gespenster eines welthistorischen Zweikampfs, der für beendet gehalten wurde, Gespenster, die mahnen, dass die monströse Ungleichheit in der Welt auf Dauer nicht zu tragen ist. Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüm: Wicke Naujoks Musik: Jörg Gollasch Choreografische Mitarbeit: Valenti Rocamora i Tora Video: Severin Renke Licht: Annette ter Meulen Dramaturgie: Judith Gerstenberg Dauer: 3 Stunden 10 Minuten, Inkl. einer Pause
Aufführungen
| Schauspiel
Die Präsidentinnen
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
In ihrer kleinstbürgerlichen Wohnküche kübeln Erna, Grete und Mariedl hemmungs- und schamlos ihren Welt-Frust über einander aus. Zwischen Abort-Phantasien, Papst-Sendungen und Dackelliebe erspinnen sie sich ihre Wirklichkeit, und die lustvollen, mit Ressentiments und Bigotterie gespickten Sprachattacken sind ihnen Horizont und billig buntes Jahrmarktfest zugleich. Den eigenen Dreck allerdings kehren sie lieber unter ihren Budenteppich – bis endlich Mariedl, die jüngste der drei Damen, ihre Kolleginnen mit der Wahrheit des Daseins konfrontiert. Doch so viel Realität hält keine aus ... Abgründig, bitterböse und gnadenlos komisch seziert Werner Schwab in seinem längst zum modernen Klassiker avancierten Fäkaliendrama die Welt der kleinen Leute: „Das sind Leute, die glauben, alles zu wissen, über alle zu bestimmen. Eine Form von Größenwahn. Ich stamme aus einer Präsidentinnen-Familie.“ Der ungarische Regisseur Victor Bodo, der im Malersaal bereits »Ich, das Ungeziefer« und »Pension zur Wandernden Nase« als rasante Grotesken inszenierte, nimmt sich diesmal das irrwitzige Sprachkunstwerk Werner Schwabs vor. Regie: Viktor Bodo Bühne: Ildi Tihanyi Kostüme: Fruzsina Nagy Musik: Klaus von Heydenaber Video: Marek Luckow Sounddesign: Gábor Keresztes Licht: Andreas Juchheim Dramaturgie: Sybille Meier, Anna Veress Dauer: 1 Stunde 45 Minuten - Keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
ANTHROPOLIS I: Prolog / Dionysos
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Prolog: Die Geschichte der Stadt Theben beginnt mit einem zweifachen Mord. Nachdem Kadmos vergeblich seine von Zeus entführte Schwester Europa auf dem Kontinent gesucht hat, wendet er sich an das Orakel von Delphi. „Vergiss die Schwester“, lautet die Antwort, „treibe eine Kuh vor dir her und dort, wo sie sich niederlässt, gründe eine Stadt.“ Kadmos hetzt die Kuh so lange vor sich her, bis sie tot zusammenbricht in der Nähe einer Quelle, die wiederum von einem Drachen bewacht wird. Den erschlägt Kadmos, bricht ihm die Zähne aus und sät sie in die Erde. Sofort wachsen aus den Zähnen bewaffnete Drachenmänner, Krieger, die sich gegenseitig niedermetzeln – nur fünf überleben das Massaker. Mit ihnen gründet Kadmos die Stadt Kadmeia, später das siebentorige Theben genannt. Von Anfang an ist die Gewalt der Zivilisationsgeschichte eingeschrieben. Schon die ersten zivilisatorischen Maßnahmen zur Gründung dieser Urstadt der westlichen Welt zeigen sich als Tötungsdelikte. Die Vernichtung des Tieres und des Tierwesens ist quasi die Voraussetzung, um überhaupt als Gesellschaft im urbanen Raum existieren zu können. Wie aber lassen sich die Gewaltakte stoppen, die die Grundfeste der Menschenstadt von Generation zu Generation aufs Neue erschüttern? Dionysos: Die Geschichte von der Geburt des Dionysos aus dem Schenkel des Zeus klingt mehr als bizarr. Kein Wunder, dass sie niemand glauben will in Theben, nachdem Dionysos’ irdische Mutter Semele, eine Tochter des Kadmos, so schändlich verbrennen musste. Angeblich hat der Erzeuger Zeus den Fötus aus dem Feuer geholt und in seinem Bein ausgetragen. Inzwischen ist Theben zu einer reichen Stadt angewachsen, und Kadmos hat den Thron an seinen Enkel Pentheus abgetreten. Da taucht Dionysos auf und behauptet, ihm stünde religiöser Kultstatus zu. Doch der auf Maß und Regeln getrimmte Pentheus verweigert ihm den Glauben. Dionysos stürzt daraufhin das Ordnungssystem des Patriarchen in eine tiefe politische und moralische Krise. Er schickt die Frauen auf einen Trip und verbreitet unter ihnen Wahnsinn und Raserei. Der Rausch endet grausam und blutig. Dionysos triumphiert über die Ungläubigen der Stadt. Er scheint eine kollektive Lust am gewaltsamen Untergang freigelegt zu haben, die dem Konstrukt „Stadt“ in seinen verdrängten Positionen innewohnt. Mit den »Bakchen« hat Euripides seine letzte und radikalste Tragödie geschrieben. Die Übertragung und Bearbeitung der »Bakchen« unter dem neuen Titel »Dionysos« verschärft die Konflikte zwischen Untergangsphantasien und Vernunftdenken, Ordnungswahn und Lust am Chaos zu heutigen Fragestellungen einer Stadtgesellschaft. Wieviel Spannungszustände sind wir noch bereit auszuhalten? Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüme: Wicke Naujoks Licht: Annette ter Meulen Musik: Jörg Gollasch Dramaturgie: Sybille Meier Dauer: 2 Stunden 50 Minuten, inkl. einer Pause
Aufführungen
| Schauspiel
ANTHROPOLIS II: Laios
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
In Theben hebt nach dem Ende des Pentheus und der Machtübernahme durch Labdakos, einem weiteren Enkel von Kadmos, eine Zeit voller Gewaltexzesse an. Schließlich wird Laios, der Sohn des Labdakos, aus dem Exil zurückgeholt und inthronisiert. Doch kommt er nicht allein, der junge Chrysippos aus Pisa begleitet ihn. Ist er der Grund für die Kinderlosigkeit des neuen Königspaares Laios und Iokaste oder ist es doch der Orakelspruch der Seherin Pythia? Schon taucht die nächste Kreatur vor den Toren der Stadt auf: die Sphinx, ein Tierwesen aus Löwe, Frau und Vogel, das die Stadt singend und rätselhaft in den mörderischen Wahnsinn treibt. In einem hochpoetischen und multiperspektivischen Monolog, der die verschiedenen Charaktere und Mythenvarianten über den Vater des Ödipus zu Wort kommen lässt, geht die Inszenierung der Frage nach, was das Paar Laios und Iokaste trotz des religiösen Verbotes dazu bewogen haben könnte, einen Nachkommen zu zeugen. Wie viel Verantwortung tragen die Eltern am Schicksal ihres Kindes Ödipus, das sie gleich nach der Geburt im Gebirge verschwinden lassen wollten? Wie viel Schuld wird von Generation zu Generation weitervererbt und wie viel Freiheit bleibt dem einzelnen, sich daraus wieder zu befreien? Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüme: Wicke Naujoks Licht: Annette ter Meulen Video: Voxi Bärenklau Musik: Jörg Gollasch Dramaturgie: Sybille Meier Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, Keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
ANTHROPOLIS III: Ödipus
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Das bekannteste Rätsel aller Zeiten wird von Ödipus gelöst. Auf die Frage der Sphinx, welches Wesen nur eine Stimme hat und manchmal zwei Beine, bisweilen drei, manchmal vier und umso schwächer ist, je mehr Beine es hat, antwortet Ödipus: „der Mensch“. Das Zeitalter des Anthropozän hat auf mythischer Ebene angefangen. Die Sphinx ist tot. Doch jetzt, da die Rätsel gelöst sind, beginnen die Probleme. Ödipus, dem gerade prophezeit worden ist, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten würde, erhält zum Dank für seinen Triumph die Herrschaft in Theben. Eine beispiellose Entscheidung der Stadt, einem Fremden die Macht zu überlassen. Zunächst scheint seine „vernünftige“ Regentschaft dem Bürgerbegehren recht zu geben. Unter seiner Regierung prosperiert die Stadt. Doch unwissend schlittert er immer tiefer in sein Schicksal hinein. Mit seiner Mutter Iokaste zeugt er vier Kinder: die Söhne Eteokles und Polyneikes und die Töchter Antigone und Ismene. Dann bricht eine Pestepidemie in Theben aus. Das ist die Stunde der Rückkehr der Religion. Apollon, die Priesterin und der Seher Teiresias holen zum Gegen schlag aus. Der Aufklärer Ödipus führt den ersten Indizienprozess der Weltliteratur gegen sich selbst. Doch wehrt er sich in einem letzten Akt der Selbstermächtigung gegen das Vermächtnis einer absoluten Wahrheit. Vergeblich? Mit »Ödipus« hat Sophokles ein Meisterwerk der Literaturgeschichte geschrieben. Bis heute inspiriert die Tragödie zu zahlreichen Neudeutungen des Macht- und Wahrheitskomplexes, dem eine Gesellschaft unterliegt. Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüme: Wicke Naujoks Licht: Holger Stellwag Musik: Jörg Gollasch Sprechtraining Chöre: Alexander Weise Dramaturgie: Sybille Meier Dauer: 1 Stunde, 45 Minuten, Keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
ANTHROPOLIS IV: Iokaste
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Von den Grenzen der Diplomatie handelt der Konflikt zwischen den Brüdern Eteokles und Polyneikes. Nach der Selbstblendung ihres Vaters Ödipus werden sie mit der Macht beauftragt. Polyneikes beschuldigt seinen Bruder, sich nicht an die Verabredung des jährlichen Regierungswechsels gehalten zu haben und droht, die Stadt Theben mithilfe von Verbündeten in einem Angriffskrieg einzunehmen. Die Mutter Iokaste zwingt die beiden an den Verhandlungstisch: Rede vor Rache. Sie appelliert an die menschliche Autonomie und die Freiheit der Wahl. Was aber, wenn subjektives Gerechtigkeitsempfinden und Recht nicht deckungsgleich sind wie im Falle von Polyneikes, der sich um den Thron geprellt sieht? Diplomatie erfordert die Fähigkeit zum Verzicht. Doch klebt das „Nicht Weichen Wollen“ geradezu symptomatisch an der Familie des Ödipus. Weder er noch sein Vater Laios haben sich den Vortritt gelassen, als sie einander an der Wegkreuzung gegenüberstanden. Eteokles rückt vom Machtanspruch ebenso wenig ab wie Polyneikes. Und die kleine Antigone wird später selbst unter Todesandrohung auf einem ordentlichen Premieren Begräbnis ihres Bruders bestehen. Inspiriert ist »Iokaste« von der Mythenbearbeitung des Euripides unter dem Titel »Die Phoenissen« und der ungefähr 60 Jahre älteren Tragödie »Sieben gegen Theben« von Aischylos. Der Text »Iokaste« dreht die Schraube weiter ins Hier und Jetzt. Moderne Krisenherde lassen sich nicht durch militärische Interventionen löschen. Seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges im Februar 2022 ist dieser Stoff des mörderischen Bruderkonfliktes und des Scheiterns der Diplomatie von erschreckender Aktualität. Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüme: Wicke Naujoks Musik: Jörg Gollasch Licht: Annette ter Meulen Video: Voxi Bärenklau Dramaturgie: Sybille Meier Bühnenbildmitarbeit: Anna Wörl Kostümmitarbeit: Teresa Heiß Dauer: 1 Stunde 45 Minuten, Keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
ANTHROPOLIS V: Antigone
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Mit Antigone, dieser unbeugsamen Rebellin gegen männliche Ordnungswut, ist das Ende der Herrscherdynastie der Labdakiden erreicht. Hier schließt sich der Kreis, und nicht zufällig stammen die berühmtesten Zeilen über den Anthropos aus dieser Tragödie des Sophokles: „Gewaltig ist vieles, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch.“ Roland Schimmelpfennig überträgt die »Antigone« in eine zeitgemäße poetische Sprache, die den weiblichen Widerstand gegen den mächtigen Staat Theben und seine Politik äußerst gegenwärtig erscheinen lässt. Antigones Onkel Kreon, der ewige zweite Mann im Staat, ist nach vielen Jahren des Stellvertreterdaseins endlich an die Macht gekommen. Gerade konnte der Angriffskrieg von Theben abgewendet werden, da droht Kreon schon an seiner ersten Amtshandlung zu scheitern: Er muss ein Urteil fällen über die Nichte Antigone, die ihr ethisches Gebot höher wertet als das Gesetz des Staates. Doch Kreon ist der Überzeugung, dass Moral ein schlechter politischer Ratgeber sei. Er verurteilt Antigone zu einer Strafe, die barbarischer nicht sein könnte: Sie soll bei lebendigem Leib eingemauert werden. Die Humanität wird der Gesetzestreue geopfert. Erneut kollabiert das System der Stadt in einem Akt der Gewalt, die sich durch die Oberfläche ihres schönen Scheines Bahn bricht. Regie: Karin Beier Bühne: Johannes Schütz Kostüme: Wicke Naujoks Licht: Annette ter Meulen Musik: Jörg Gollasch Dramaturgie: Sybille Meier, Christian Tschirner Mitarbeit Kostüme: Theresa Heiß Körperarbeit: Valentí Rocamora i Torà Dauer: 1 Stunde, 25 Minuten
Aufführungen
| Schauspiel
Bernarda Albas Haus
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Die Tür ist zu. Für die nächsten acht Jahre darf keine der Frauen das Haus verlassen, so verlangt es eine Tradition, die nach dem Tod des Mannes eine Trauerphase diesen Ausmaßes anordnet. Die fünf Töchter stehen unter Schock. Ihre Mutter Bernarda Alba setzt die Vorschrift unerbittlich um, und wenn es sein muss mit Gewalt. Das Haus wird zum Gefängnis. Abgeriegelt von der Welt und eingesperrt mit ihrem Hunger nach Leben, ihrer stillgelegten Sexualität und dem Begehren von Freiheit und Würde macht sich die Wut auf das repressive patriarchale System unter den Frauen breit. Bald richten sie den Schmerz gegen sich selbst und die anderen, bis es zur Katastrophe kommt. Mit »Bernarda Albas Haus«, seinem letzten Stück kurz vor seiner Ermordung durch die Faschisten der spanischen Militärdiktatur, hat der Dichter Federico García Lorca eine der eindrucksvollsten Tragödien des 20. Jahrhunderts geschaffen. Die britische Autorin Alice Birch macht das erschütternde Drama um weibliche Unterdrückung, verhindertes Begehren und gewalttätige Generationskämpfe zu einer gegenwärtigen Bühnenerzählung. Dabei entwickelt sie das kunstvolle Kompositionsprinzip der simultanen Parallelmontage weiter, das sie gemeinsam mit der Regisseurin Katie Mitchell beeindruckend in der Inszenierung »Anatomie eines Suizids«, eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2020, angewandt hat. Alice Birch zählt zu den erfolgreichsten britischen Theater- und Film-Schriftsteller*innen. Zuletzt hatte sie als Drehbuchautorin der international gefeierten Serie »Normal People« auf Grundlage des Weltbestsellers von Sally Rooney für Furore gesorgt. Regie: Katie Mitchell Bühne: Alex Eales Kostüme: Sussie Juhlin-Wallen Licht: James Farncombe Komposition: Paul Clark, Melanie Wilson Original-Soundesign: Melanie Wilson Dramaturgie: Sybille Meier Dauer: 1 Stunde 30 Minuten, Keine Pause
Aufführungen
| Schauspiel
Die Möwe
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Wie nervös alle sind, so nervös! Als junge erfolglose Künstler*innen glauben sie, alle Konventionen sprengen zu können und verlieren – endlich erfolgreich – den Glauben an ihre Arbeit. Sie wollen ein bedeutendes Leben führen in den Zentren der Welt und arrangieren sich tapfer in der Provinz. Sie wollen die Gesellschaft erneuern und werden von sich selbst enttäuschte Schauspieler*innen, Lehrer*innen oder Verwalter*innen. Sie suchen die eine, die große Liebe und heiraten schließlich leidenschaftslos eine andere. Fast alle Figuren, die Anton Tschechow in »Die Möwe« versammelt, sind irgendwo angekommen. Aber niemand dort, wo er oder sie eigentlich einmal hinwollte. Sie bilden einen Reigen unglücklich liebender, grandios oder kleinlaut scheiternder Menschen. Es ist eine Tragödie, es ist eine Komödie. Die Regisseurin Yana Ross inszeniert zum ersten Mal in Hamburg. Seit ihrer frühesten Kindheit führt die Kosmopolitin ein für ihr künstlerisches Schaffen fruchtbares Nomadenleben: In Moskau als Kind einer ukrainisch-polnisch-jüdischen Familie geboren, aufgewachsen im Baltikum und den USA, lebt und arbeitet sie seither in verschiedenen Ländern Europas. Zuletzt gehörte sie fünf Jahre zum Leitungskollektiv des Schauspielhauses Zürich. Immer wieder aufs Neue sucht sie die Texte Anton Tschechows auf: Kein anderer Autor sequenziere die DNA der menschlichen Seele so präzise wie er. Gemeinsam mit dem Ensemble taucht sie tief in das Original ein, befragt Tschechows Dramatik nach den persönlichen Bezugspunkten und schreibt sie in die Gegenwart fort. Aus dem Russischen von Elina Finkel in einer Bearbeitung von Yana Ross Regie: Yana Ross Bühne: Bettina Meyer Kostüme: Ulrike Gutbrod Musik: Knut Jensen Licht: Susanne Ressin Dramaturgie: Matthias Günther 2 Stunden 45 Minuten, inkl. einer Pause
Aufführungen
| Film
Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Internationales Musikfest Hamburg
(Regie: Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, D 1975) Musik erhebt Anklage Die Elbphilharmonie widmet Hans Werner Henze zu dessen 100. Geburtstag einen Schwerpunkt im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg. Da dürfen auch Henzes künstlerische Ausflüge in die Filmwelt nicht fehlen: Das Zeise Kino zeigt Volker Schlöndorffs Verfilmung »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, basierend auf Heinrich Bölls gleichnamiger Erzählung und mit Musik von Henze. Eine pointierte Anklage gegen die Macht der Medien und den Verlust individueller Würde im Spannungsfeld von Staat und Sensation. In diesem Fall bat Henze den Regisseur Schlöndorff sogar selbst darum, die Musik beisteuern zu dürfen. Der schon berühmte Komponist Henze, durch Medienskandale gezeichnet, verarbeitet in der Musik eigene Erfahrungen von Rufmord und öffentlicher Demontage. Herausgekommen ist ein Soundtrack, der nicht nur begleitet, sondern kommentiert und anklagt. »Das hatte auch was mit Politik zu tun. Die Musik konnte helfen, die Böllsche und die Schlöndorffsche Alarmglocke zu läuten«, sagte Henze. Seine kammermusikalischen Klangepisoden, durchzogen von Schlagzeugeffekten und düsteren Zitaten aus Wagners »Rheingold«, wurden zur klanglichen Grundlage des Filmschnitts – als finstere Hommage an die Bonner Republik.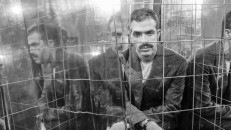
Aufführungen
| Oper
Leonard Bernstein: Mass / Omer Meir Wellber
Internationales Musikfest Hamburg
Philharmonisches Staatsorchester Hamburg Audi Jugendchorakademie Hamburger Alsterspatzen Hamburger Knabenchor Will Liverman, Celebrant Dirigent: Omer Meir Wellber Alexander Radulescu, Szenische Einrichtung, Video Constantin Trommlitz, Choreografie Leonard Bernstein: MASS / A Theatre Piece for Singers, Players and Dancers Ein großes Orchester, drei Chöre, über 200 Mitwirkende von Gesang über Tanz bis hin zur Rockband: Leonard Bernsteins »Mass« sprengt alle Dimensionen. Mit der Aufführung setzt Hamburgs neuen Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber die Reihe spektakulärer Sonderproduktion beim Internationalen Musikfest fort. Dass das FBI den US-Präsidenten vor einer Uraufführung warnt, klingt absurd, geschah aber 1971 bei Bernsteins »Mass«. Zu aufgeheizt waren die Zeiten von Vietnamkrieg, Bürgerrechtsbewegung und Kennedy-Ermordung, zu heikel der Inhalt: Statt einer konventionellen Messvertonung erklingt eine Art Performance, die den katholischen Messritus dekonstruiert und zu einer politischen Demonstration umfunktioniert. Lateinische liturgische Gesänge weichen Gospelgesang, Cool Jazz, Rock, Marschmusik, Broadway-Swing, indischen Ragas und expressionistischer Avantgarde. Zwischen Ritus und Rebellion entsteht ein gewaltiges Klangmosaik, das in den überwältigenden Ruf nach Frieden mündet. Staatsopern-Generalmusikdirektor Omer Meir Wellber bringt das aufwändigste Projekt des diesjährigen Musikfests in die Elbphilharmonie und am Sonntagmittag auch als Video-Übertragung auf die Michel-Wiese. Dort finden im Anschluss alle Beteiligten zusammen und laden zu einem kreativen Wiesenfest mit Musik, Kulinarik, Performances und Workshops ein.
Aufführungen
| Schauspiel