Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Neben der großen Bühne finden auch Veranstaltungen im MarmorSaal (1. Rang) und im RangFoyer (2. Rang) sowie im Restaurant Theaterkeller statt.

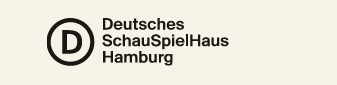
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg bewerten:
Bewertungen & Berichte Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
alphabet bewerten:
Bewertungen & Berichte alphabet
Das Bildnis des Dorian Gray bewerten:
Bewertungen & Berichte Das Bildnis des Dorian Gray

Die Möwe bewerten:
Bewertungen & Berichte Die Möwe

Das große Heft bewerten:
Bewertungen & Berichte Das große Heft

Vampire’s Mountain bewerten:
Bewertungen & Berichte Vampire’s Mountain

A Perfect Sky bewerten:
Bewertungen & Berichte A Perfect Sky

Hamlet bewerten:
Bewertungen & Berichte Hamlet
Mein Schwanensee bewerten:
Bewertungen & Berichte Mein Schwanensee
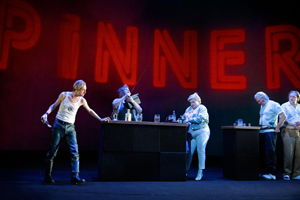
Ein Sommer in Niendorf bewerten:
Bewertungen & Berichte Ein Sommer in Niendorf
ANTHROPOLIS I: Prolog / Dionysos bewerten:
Bewertungen & Berichte ANTHROPOLIS I: Prolog / Dionysos
ANTHROPOLIS II: Laios bewerten:
Bewertungen & Berichte ANTHROPOLIS II: Laios
ANTHROPOLIS III: Ödipus bewerten:
Bewertungen & Berichte ANTHROPOLIS III: Ödipus
ANTHROPOLIS IV: Iokaste bewerten:
Bewertungen & Berichte ANTHROPOLIS IV: Iokaste

ANTHROPOLIS V: Antigone bewerten:
Bewertungen & Berichte ANTHROPOLIS V: Antigone
Herr Puntila und sein Knecht Matti bewerten:
Bewertungen & Berichte Herr Puntila und sein Knecht Matti
Bernarda Albas Haus bewerten:
Bewertungen & Berichte Bernarda Albas Haus
Die Präsidentinnen bewerten:
Bewertungen & Berichte Die Präsidentinnen
Ab jetzt bewerten:
Bewertungen & Berichte Ab jetzt
Toller Online-Spielplan mit technisch aufwendigen Produktionen und Mitschnitten.

Société Anonyme bewerten:
Bewertungen & Berichte Société Anonyme

Virtueller Rundgang bewerten:
Bewertungen & Berichte Virtueller Rundgang
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg bewerten:
Bewertungen & Berichte Deutsches SchauSpielHaus Hamburg
Sie haben noch keinen Login? Dann registrieren Sie sich gleich hier!
Bitte schauen Sie in Ihrem E-Mail-Postfach nach der Registrierungsmail und klicken Sie auf den darin enthaltenen Link.
